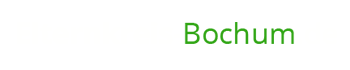Ein Geschwisterkind berichtet
Meine Eltern haben den 2. Weltkrieg körperlich unversehrt überlebt. Nach dessen Ende waren sie noch sehr jung, meine Mutter zählte gerade einmal 15 Jahre, mein Vater war immerhin 22, sollte aber erst mit 28 – nach einer Kriegsgefangenschaft in Russland – wieder in die Heimat kommen. Die unsichtbaren Beschädigungen der Seele lagen jedoch zeitlebens wie dunkle Schatten auf ihnen und damit auf unserer Familie. Alkohol galt in dieser Zeit als probates Heilmittel.
Ich erblickte als Wunschkind das Licht der Welt. Die schrecklichen Kriegszeiten waren zwar vorbei – mittlerweile war das Wirtschaftswunder ausgebrochen – aber es lag ein Mantel des Schweigens über der Vergangenheit. Meine Schwester ist etwas mehr als 4 Jahre älter als ich, sie hat sicherlich noch, mehr als ich, eine Zeit der Entbehrung erlebt. Wir beide hatten aber das Glück eine herzensgute Urgroßmutter mit im Haushalt zu haben. Sie hielt uns fern von vielen dramatischen Familiensituationen. Auch war sie immer für Trost oder eine liebevolle Umarmung zu haben.
So wuchs ich in einer vermeintlich glücklichen Kindheit zu einem 9-jährigen Jungen heran, als unsere Mutter plötzlichen und unerwarteten Familienzuwachs bekannt gab: mein Bruder kam auf die Welt! Als Baby war er ein wahrer Sonnenschein. Ich habe ihn von Anbeginn geliebt und war stets bereit, Betreuungsaufgaben für ihn zu übernehmen.
Das Elternhaus verließ ich schon mit 17 Jahren. Ich fand eine preiswerte kleine Wohnung mit Kohleofen und ohne Bad. Mein Bruder kam gern nach der Schule – oder auch mal spontan – auf einen kürzeren oder längeren Besuch vorbei, häufig begleitet von einer Freundin, einem Freund oder von Schulkolleg*innen. Wir alle genossen die gemeinsamen Zeiten sehr. Mein Bruder auch deshalb, weil er seinen Begleiter*innen elternfreie Zeit und alternative Wohnformen anbieten konnte. Wir feierten hier manche Spontanparty und es kreisten auch schon mal Joints.
Eines Tages nahm mich ein guter Freund meines Bruders zur Seite, um mir im Vertrauen zu offenbaren, dass sich mein Bruder von alten seiner Clique absondere und er nun mit starken Schmerzmitteln, Psychopharmaka und anderen Medikamenten experimentiere.
Von da an änderte sich alles …
Mein Bruder veränderte sich grundlegend. Er sonderte sich komplett von alten Freunden ab und auch die Besuche bei mir reduzierten sich deutlich. Wenn er da war, bemühte ich mich oft herauszufinden, was er so treibt, welche Kontakte er nun hat und was genau er konsumiert. So manche Nacht diskutierten wir zu zweit, zu dritt mit meiner Lebensgefährtin oder mit der gesamten alten Clique seinen aktuellen Konsum, um ihn möglichst davon abzubringen. Genaues erfuhren wir hierzu zumeist nicht, nur so viel, dass er von Opiaten besonders angetan war. Er ließ er sich absolut nicht von der Gefahr seines Konsums überzeugen, sondern schwärmte von den angenehmen Gefühlen, die er so noch nie zuvor verspürt habe. Mir blieben ein unbestimmtes Gefühl der Trauer und die Angst ihn für immer zu verlieren.
Gegenüber den Eltern erwähnte ich lange nichts von diesen Entwicklungen. Eher hegte ich noch die Hoffnung – manchmal gar die irrationale Überzeugung -, meinen Bruder noch auf einen sicheren Weg zurückführen zu können. Dabei war er längst abgebogen, hatte endlich geeignete Mittel gefunden, die ihm Ängste nehmen und seinem Leben vermeintlich Sinn geben konnten. Gleichwohl bemühte ich mich darum, den Kontakt zu halten, organisierte zum Beispiel regelmäßige Geschwistertreffen, die tatsächlich einige Zeit funktionierten und einen Austausch ermöglichten. Im Laufe der Zeit wurde mein Bruder jedoch zunehmend unkonzentrierter und schläfriger. Als es ihm eines Tages bei einem dieser Treffen nicht mehr gelang die Augen offenzuhalten und sein Kopf schwer auf den Tisch sank, beendete ich diese Treffen. Ich bedauere heute, dass meine Schwester und ich die Treffen nicht zu zweit fortsetzten. Doch wer weiß, wie lange dies möglich gewesen wäre. Denn letztlich verbot der Partner meiner Schwester ihr sogar den Umgang mit unserem Bruder und erteilte ihm Hausverbot. Sie fügte sich leider diesem Gebot. Unseren Bruder verletzte dies zutiefst und er leidet bis heute darunter.
Die Kontakte zu meinem Bruder wurden nun zusehends seltener – er war ohnehin nicht mehr wirklich erreichbar – ständig war er völlig breit und zu normalen Gesprächen nicht mehr in der Lage. Ich zog mich daher von ihm zurück und vermisste ihn gleichzeitig schmerzhaft. Erst viel später erfuhr ich von ihm, dass er in dieser Zeit begann Heroin zu drücken. Sein Leben drehte sich nunmehr ausschließlich um Konsum und Beschaffung. Dennoch kümmerte ich mich wiederholt in Notsituationen um ihn und vermittelte endlich auch unseren Eltern mein Wissen über Sucht und Drogen. Schließlich studierte ich Sozialwissenschaften und fand mich daher fachlich geeignet! Immer wieder gab es Situationen, in denen ich mich gefordert fühlte einzugreifen. Sei es, bei suizidalen Episoden oder Problemen aus dem Umfeld der Beschaffung. Oftmals vermittelte ich zwischen ihm und unseren Eltern, stellte gemeinsame Regeln auf, entwarf Verträge und so weiter. Immer wieder bot ich ihm meine Hilfe an, vor allem beim Ausstieg. Aber ich lehnte den Kontakt ab, wenn er zugeknallt war. Die Hoffnung auf sein drogenfreies Leben gab ich allerdings nie auf.
Dann schloss ich mein Studium ab, zog in ein alternatives Wohnprojekt, begann eine erfolgreiche Selbstständigkeit und ließ mich auf eine Wiederbelebung einer Partnerschaft zur Ex ein. Eigentlich lief jetzt alles bestens, die Feier zum 30. Geburtstag war wahrlich grandios. Seltsamerweise verdunkelte sich mein Gemütszustand zunehmend und ich schlitterte geradewegs eine manifeste Depression. Meinen Bruder sah ich nur noch selten.
Es dauerte einige Zeit, bis ich mich zu einer Psychotherapie aufraffen konnte. Mit deren Hilfe gelang mir eine erste, mühevoll erarbeitete Ablösung von meinen Eltern. Doch die Aufgabe, meinem Bruder beizustehen, gab ich nicht auf. Es sollte noch lange dauern bis ich verstand, dass ich bei ihm Eltern-aufgaben wahrnahm, die mir keinesfalls zustanden. Außerdem wollte ich lange nicht wahrnehmen, wie groß Schmerz und Trauer wirklich waren, wenn ich daran dachte meinen Bruder zu verlieren.
Solange unsere Eltern lebten, haben sie ihren drogenabhängigen Sohn aktiv unterstützt, sowohl emotional als auch finanziell. Die emotionale Ebene war vielleicht ein wenig unbeholfen, doch er konnte sich jederzeit mit seinen akuten Problemen an sie wenden und ihre Aufmerksamkeit erhalten. Dies galt ebenso für die Begleitungen zu Entgiftungen, die unser Vater organisierte, wie für sein Zuhören während stundenlanger „Redeflashs“ am Telefon. Diese Tatsachen habe ich offenbar verdrängt. Ich war der festen Meinung, ich hätte die Elternaufgaben komplett übernommen, und glaubte unsere Eltern hätte die Situation völlig überfordert. Mein Bruder erzählte mir zu meiner Überraschung kürzlich, dass er sich durchaus von ihnen unterstützt fühlte.
Um gemeinsame Zeit mit unseren, allmählich alternden, Eltern zu verbringen, organisierte ich regelmäßige Ausflüge, Spaziergänge, Restaurant- oder Eisdielenbesuche. Meinen Bruder lud ich ebenfalls dazu ein, doch nur unter der Voraussetzung, dass er pünktlich ist und nicht abgefüllt erscheint. Er versuchte zunächst seine Bedingungen bei diesen Treffen durchzusetzen, was zu teilweise sehr heftigen Streitereien führte. Hier war ich jedoch zumeist konsequent und ließ mich nicht darauf ein. Langsam wurden die Familienausflüge daher zunehmend harmonischer.
Nach dem Tod unserer Eltern, führte ich die Ausflugstradition mit meinem Bruder fort und er nahm das Angebot dankend an. Mittlerweile war er tatsächlich zuverlässiger geworden und es gab weniger Streitereien. Leider konnte er jedoch seinen Diazepinkonsum nicht zügeln. Er geriet zusehends in eine psychotische Episode und entwickelte zudem suizidale Gedanken. Zwischenzeitlich bahnte ich eine ambulante Betreuung für ihn an, die aber leider erst nach einer Wartezeit starten würde. Im Vorgespräch erhielten wir den Rat, mein Bruder solle sich in dieser kritischen Situation unbedingt klinisch behandelt lassen. Zunächst weigerte er sich angstvoll, doch in langen Gesprächen überzeugte ich ihn. Schließlich stimmte er einem Klinikaufenthalt zu. Ich begleitete ihn zur Aufnahme und besuchte ihn täglich.
Diese akute Krise war für mich sehr belastend. Welche massiven Folgen die Entgiftung von Benzos hat, hatte ich schlicht nicht gewusst. Ich kam an meine Belastungsgrenze und musste mich endlich einmal um mich selbst kümmern. Die örtliche Drogenhilfe machte mir leider keine Hilfsangebot. Stattdessen empfahl sie mir die Selbsthilfe im Elternkreis der Stadt. Hier wurde ich tatsächlich herzlich aufgenommen und ich erlebte die Treffen und Gespräche mit betroffenen Eltern als sehr entlastend. Später übernahm ich selbst Aufgaben für den Kreis, organisierte Fortbildungen und Seminare und nahm zugleich an Veranstaltungen des Landesverbandes teil, dem ich später auch leitend zur Seite stand. Erst hier erkannte ich allmählich, dass sich meine Position eines Geschwisterkindes grundlegend von derjenigen der Eltern unterscheidet.
In dieser Zeit gelang es mir endlich auch, meine Scham über die Drogensucht meines Bruders zu verlieren und offen mit anderen über die Problematik zu reden. Mein Bruder, inzwischen stabil substituiert und beikonsumfrei, wird nun durch die, von mir initiierten Dienste, der gesetzlichen und ambulanten Betreuung sehr gut unterstützt. Er hat die harte Konsumzeit überlebt und sogar seine Wohnung behalten. Darauf blicke ich heute mit Stolz zurück, da ich einen großen Anteil daran habe. Jedoch benötigte ich noch längere Zeit und etliche weitere Therapiestunden, bis es mir gelang, die Verantwortung für das Leben meines Bruders abzugeben. Noch heute ertappe ich mich manchmal bei dem Gedanken, ich hätte die Macht, durch eine meiner Äußerungen oder Handlungen könnte ich einen Rückfall bei meinem Bruders auslösen. Hingegen führt die wachsende Loslösung zu einer Stärkung meiner Identität und zugleich zur Verbesserund des Verhältnisses zueinander. Beide profitieren heute von der so zugewonnenen persönlichen inneren Freiheit.
Gleichwohl sehe ich mich längst nicht am Ende der Aufarbeitung meiner Geschwisterrolle. Gern möchte ich diese Problematik weiter aufarbeiten, denn die Informationslage zur Situation von Geschwisterkindern in Familien mit einem drogenkonsumierenden Kind ist sehr dünn und Studien hierzu liegen bisher nicht vor. Geschwisterkinder haben offenbar eine größere Hemmschwelle, ihre Situation als problematisch zu erkennen als Eltern. Die Gründung von Selbsthilfegruppen nur für Geschwisterkinder wäre hier bestimmt hilfereich und weiterführend. Darum freue mich sehr darauf, von anderen Geschwisterkindern und deren Geschichten zu hören …